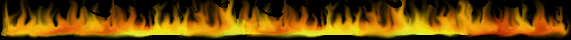
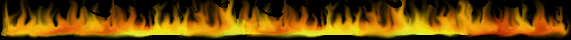
4. Bau der Erde und Vulkanismus
Vulkanismus tritt grundsätzlich an aktiven Schwächezonen der Erdkruste auf. Vulkane finden sich vor allem an Plattengrenzen, wie im Bereich der mittelozeanischen Rücken, Inselbögen und Kontinentalränder (z. B. beim "Zirkumpazifischen Feuerring). Der Aufbau der Erde, Plattenbewegungen und Vulkanismus hängen sehr eng zusammen.
Schon die alten Griechen berechneten den Erddurchmesser auf etwa 12.750 km. Doch erst um 1900 postulierte man den dreiteiligen Aufbau unseres Planeten aus Erdkruste, Erdmantel und Erdkern.
Erdkruste und Erdmantel werden durch die"Mohorovicic-Diskontinuität", Erdmantel und Erdkern werden durch die "Wiechert-Gutenberg-Diskontinuität" voneinander getrennt (Diskontinuität = Grenzfläche).
|
|
|
|
Schalenbau der Erde (nach W. J. Kious & R. I. Tilling, U. S. Geological Survey). |
Plattenbewegungen und Konvektionsströmungen im Erdmantel (nach W. J. Kious & R. I. Tilling, U. S. Geological Survey). |
Die äußerste, starre Schale der Erde ist die Erdkruste. Sie wird in Obere und Untere Kruste unterteilt und ist unter den Ozeanen nur etwa 5 km, unter den Kontinenten 30-100 km mächtig.
Unterhalb der Erdkruste liegt der Erdmantel. Er gliedert sich in den Oberen und Unteren Erdmantel, besteht aus dichtem, heißem, teilweise geschmolzenem Gestein und reicht bis in 2900 km Tiefe.
Der Erdkern im Zentrum der Erde setzt sich aus dem ca. 2200 km mächtigen, flüssigen Äußeren Kern und dem etwa 1250 km mächtigen, festen Inneren Kern zusammen. Dieser flüssige Teil des Erdkerns erzeugt zusammen mit der Erdrotation das Magnetfeld der Erde.
5. Plattentektonik und Vulkanismus
Der Schalenbau der Erde und damit zusammenhängende Bewegungen führen zur Plattentektonik. Der Obere Erdmantel ist kühler und starrer als der Untere Erdmantel. Die Erdkruste und der Obere Mantel bilden zusammen die Lithosphäre mit durchschnittlich 80 km Dicke. Unter den Ozeanen und in vulkanisch aktiven kontinentalen Gebieten ist die Lithosphäre dünner und in Platten zerbrochen, die sich gegeneinander verschieben. Man nimmt an, unterhalb der Lithosphäre befinde sich eine relativ dünne, mobile Zone im Erdmantel, die Asthenosphäre. Sie enthält vermutlich einen gewissen Anteil an geschmolzenem Gestein.
|
|
|
Querschnitt durch die Asthenosphäre und Lithosphäre. Gekennzeichnet sind die Haupttypen der Plattengrenzen (nach der Wandkarte von J. F. Vigil "This Dynamic Planet", U. S. Geological Survey). |
Dieser geringe Anteil an Schmelzen ermöglicht Plattenbewegungen und speist die tiefen Magmaquellen der Vulkane. Brüche in der Erdkruste an den auseinanderstrebenden Plattengrenzen sind dafür verantwortlich, daß das teilweise aufgeschmolzene Gestein an die Erdoberfläche dringt und Vulkane entstehen.
Die Erdoberfläche besteht aus 10-12 tektonischen Groß- und etlichen kleineren Platten. Bei tektonischen Platten handelt es sich um massive, unregelmäßig geformte Gesteinskörper, die aus kontinentaler und/oder ozeanischer Lithosphäre aufgebaut sind. Ihr Durchmesser beträgt wenige hundert bis viele tausend Kilometer. Ihre Mächtigkeit liegt unter 15 km im Bereich junger ozeanischer Lithosphäre und erreicht bis zu 200 km im Bereich alter kontinentaler Lithosphäre.
|
|
|
Physische Weltkarte mit der globalen Verteilung der Lithospärenplatten (Quelle: National Geophysical Data Center NGDC, USA). |
|
|
|
|
Zusammenhang zwischen Vulkanismus und Plattentektonik (nach L. Topinka, U. S. Geological Survey in W. J. Kious & R. I. Tilling, U. S. Geological Survey). |
Plattenbewegungen am Mittelatlantischen Rücken (Quelle: U. S. Geological Survey und National Geophysical Data Center NGDC, USA). |
Man unterscheidet:
Divergente Plattengrenzen: Die beteiligten Platten driften auseinander mit Spreizungsraten bis zu 18 cm/Jahr; neue Kruste entsteht durch ausströmende Lava, zum Beispiel am Mittelatlantischen Rücken.
Konvergente Plattengrenzen: Eine Platte schiebt sich unter die andere; alte Kruste wird beim Abtauchen "verschluckt", zum Beispiel am "Zirkumpazifischen Feuerring", der von Neuseeland über Alaska bis zur Südspitze Südamerikas reicht.
Transformstörungen: Zwei Platten gleiten horizontal aneinander vorbei; es wird weder neue Kruste gebildet noch alte zerstört, z. B. am San Andreas-Graben, Kalifornien.
|
|
|
Plattenbewegungen am Ozeanboden und relative Alter der einzelnen Segmente zueinander (Mit freundlicher Genehmigung: Understanding Earth von Frank Press und Raymond Siever © 1994, 1998, W. H. Freeman and Company). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plattenbewegungen an: a) divergenten Plattengrenzen, b) konvergenten Plattengrenzen, c) Transformstörungen. (Quellen: linke Seite: modifiziert nach C. Lithgow-Bertelloni, University of Michigan, Ann Arbor; Mitte: TheTech Museum of Innovation, San José, Kalifornien; rechte Seite: National Oceanographic and Atmospheric Administration's National Geophysical Data Center). |
||
|
|
|
|
|
Konvergente Plattengrenzen. Subduktion von (nach W. J. Kious & R. I. Tilling, U. S. Geological Survey). |
|
|
Mineralogisches Museum (Kristalle und Gesteine) Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
|
Ausstellung und Texte: C. Schmitt-Riegraf W. Riegraf |
|